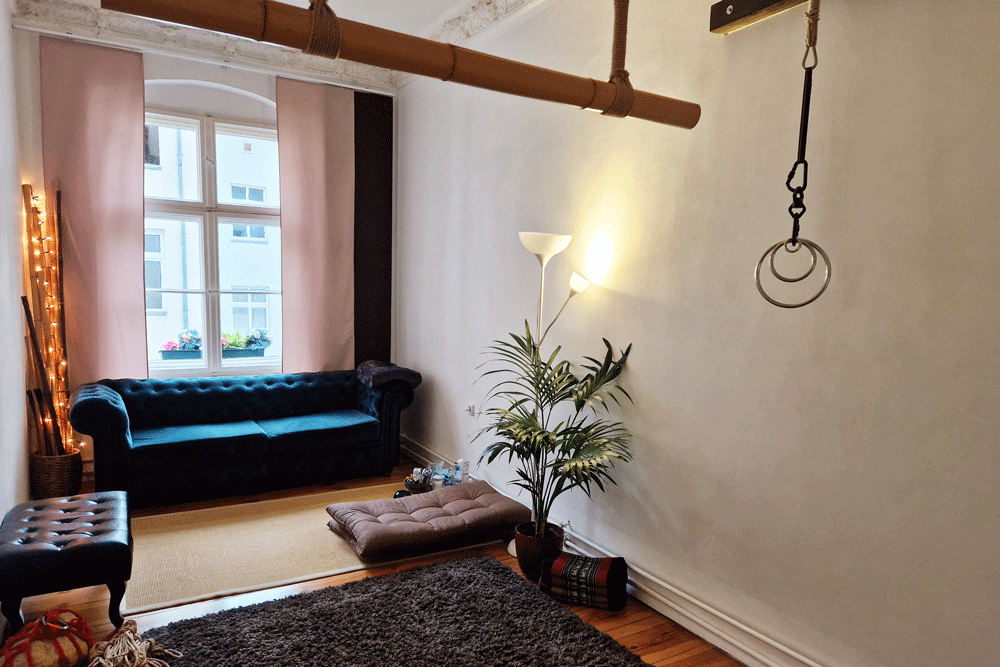Das kann durchaus sein. Allerdings ist dies von so vielen Faktoren abhängig, dass es schlicht weg falsch wäre, diese Annahme zu generalisieren. Warum möchte ich nachfolgend erläutern.
1. Ist es sehr stark von der Fesselung abhängig, ob diese als schmerzhaft empfunden wird oder nicht. Hierbei spielt das Material (z.B. einschneidende, brettharte Seile oder anschmiegsame Seile) genauso eine Rolle wie der Seilduktus des:der Fesslers:in (z.B. fließend und gleichmäßig/ sehr eng und ruppig), die Art der Fesselung (einfaches Hände zusammen binden vs. komplexe Figur mit viel Seil am Körper) und die dafür erforderliche Körperhaltung (z.B. bequem auf dem Boden sitzend oder mit dem Rücken überdehnt nach hinten). Einige Fesselungen sind natürlich anspruchsvoller als andere. Es gibt jedoch genügend Fesselfiguren, welche mit einem Minimum an Anspruch an die Gefesselten auskommen und als verhältnismäßig bequem von den meisten Menschen empfunden werden.
2. Ist es ebenso stark von der gefesselten Person abhängig, wie diese die Fesselung erlebt. Hier spielen generelle Lebenseinstellung, Vorerfahrungen und die Herangehensweise genauso mit rein wie körperliche Aspekte, wozu u.a. die Dehnbarkeit, Beweglichkeit und Statur zählen. Mit einer körperlich schwerere Person kann unter Umständen nicht jede Fesselung und/oder Hängung auf genau dieselbe Weise durchgeführt werden, wie mit einer etwas leichteren – schließlich wirken verstärkte Zugkräfte und die Druckempfindsamkeit der Haut wird stärker beansprucht. Dieselbe Fesselfigur kann also je nach Statur und Körpergewicht der betreffenden Person mehr oder weniger schmerzhaft werden. Ebenso wird eine Hängefigur, bei der z.B. die Beine hinter dem Rücken nach oben gezogen werden, einer weniger gut gedehnten Person schwerer fallen und damit unangenehmer und schmerzhafter sein, als einer aktiv Yoga praktizierenden oder Ballett trainierenden (d.h, gut dehnbaren) Person, für die diese Bewegung zum normalen Repertoire des Körpers gehört.
3. Wie schon oben erwähnt, spielt auch der persönliche Umgang mit Schmerzen eine wichtige Rolle: Schmerzempfindungen können sich im Laufe des Lebens einer Person verändern. Dies ist nachweisbar an der Modifizierung eines Gens, auf dem die Information für das Protein der Nozizeptoren liegt. Es handelt sich dabei um die freien Nervenendigungen, die thermische, chemische oder mechanische Reize wahrnehmen können und für die Registrierung von Verletzungen zuständig sind. Je nach Modifikation – also den bereits gemachten Lebenserfahrungen mit Schmerzen – wird das Protein häufiger oder seltener von den Zellen hergestellt. [1] Wissenschaftler haben zudem herausgefunden, dass neben individuellen Vorerfahrungen auch die Gene, die Gehirnstruktur sowie das Geschlecht und die Haarfarbe die Intensitätswahrnehmung des Schmerzes beeinflusst. So reagieren Rothaarige im Unterschied zu Brünett- oder Schwarzhaarigen zwar empfindsamer auf Hitze- oder Kälteschmerz, jedoch unempfindlicher auf Druckreiz. Grund dafür ist eine bestimmte Variante des Gens Mc1r, welches neben der roten Haarfarbe auch den Bau und die Funktion sogenannter Opioidrezeptoren steuert. Das sind Rezeptoren, welche durch die körpereigenen Schmerzmittel Endorphine und Enkephaline angeregt werden und an den Verbindungen zweier Nervenzellen sitzen.
Interessant ist auch, dass Männer mehr Endorphine und Enkephaline bei Schmerz ausschütten, als Frauen. Was bedeutet, dass die Männer denselben Schmerz durch die verstärkte Aktivierung der Opioidrezeptoren als schwächer empfinden. Das körpereigene Schmerzhemmsystem ist bei Männern nach den Ergebnissen der Forscher daher besser, als das der Frauen. Letztere können dafür jedoch sehr viel besser sensorische Empfindungen (wie Temperaturabweichungen oder Gerüche) differenzieren und Schmerzen damit generell besser wahrnehmen und deutlicher beschreiben. Zudem beeinflusst der Hormonspiegel die Schmerzwahrnehmung von Frauen. In der Phase ihrer Menstruation werden auch mehr Endorphine ausgeschüttet und es sind mehr Opioidrezeptoren vorhanden. Daher sind Frauen an diesem Punkt ihres Zyklus am wenigsten Schmerzanfällig- aufgrund der Hormone können sie Schmerzen zu diesem Zeitpunkt ähnlich gut tolerieren wie Männer. Weiter reagieren Menschen, welche nur selten Tagträumen oder ihren Gedanken nachhängen – also ihr Gehirn im Ruhezustand halten – stärker auf Schmerzen, als andere.
Wir sehen also, dass es allein schon aus wissenschaftlicher Sicht zahlreiche Faktoren gibt, welche das Schmerzempfinden eines Menschen beeinflussen können.
4. Bondage soll mitunter weh tun. Der vielleicht am schwersten nachvollziehbare Punkt. Aber es gibt zu genüge Menschen, die sich bewusst in starke Schmerzerfahrungen hineinbegeben – und dies immer wieder und mit Freude. Warum, fragt man sich da? Eine mögliche Erklärung dazu lautet: Schmerzen veranlassen den Körper dazu, Endorphine auszuschütten, welche den Schmerz hemmen und zugleich Hochgefühle in uns auslösen können. Aus der eigentlichen Schmerzerfahrung wird eine tiefgehende Körpererfahrung. Es entsteht daher in einer guten Bondage-Session beim passiven Partner eine Mischung von Lust und Schmerz. Beide Empfindungen können, mal philosophisch betrachtet, als „die entscheidenden menschlichen Grund- und Grenzerfahrungen“ verstanden werden und „die Lebendigkeit und Leiblichkeit menschlicher Existenz“[1] durch die Einheit von Körper und Bewusstsein in einer besonderen Klarheit und Tiefe erfassbar machen. Hinzu kommt der Aspekt der Wehrlosigkeit und Immobilität durch das Gefesselt sein– es entspricht der Aufgabe des Willens und dem Verzicht auf die Kontrolle des Geschehens. Genau das ist nach der Philosophin Elisabeth List das wichtigste Merkmal ekstatischer Lustempfindungen: „Der freiwilligen Aufgabe der Ichgrenzen und des eigenen Körpers als kontrollierbares Objekt“. [2] Die Grenzerfahrung, die Körperwahrnehmung, der Schmerz, die Hingabe und der Kontrollverlust – das alles begünstigt tranceartige Glückserfahrungen. Dem Schmerz kommt zudem eine den Geist fokussierende Wirkung zu. Eine Art Meditation oder Trance – nicht wenige Bondage-Fans empfinden daher anspruchsvolle und schmerzhafte Hängungen oder besonders enge Fesselungen als den Geist läuternd und befreiend. Hochgefühle inklusive.
5. Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Normalerweise soll uns Schmerz vor Krankheiten oder Verletzungen schützen und uns davor warnen. Anders verhält es sich beim Bondage, bei dem der Körper des Gefesselten oder Hängenden unter Umständen zwar stark beansprucht wird und Schmerzen empfindet, diese jedoch nicht als Warnung für Krankheiten oder Verletzungen verstanden werden brauchen. Eine im Leben einzigartige Erfahrung. Denn bei guten Fesselsessions kommt es in der Regel nicht zu unabsichtlichen Verletzungen oder Unfällen. Daher ist es möglich, aufkommende Schmerzen zu ignorieren, bzw. tut dies der Körper von selbst, sofern er zuvor einige Erfahrung mit anspruchsvollen Fesselvarianten machen konnte. Dies mag von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Ein Gewöhnungseffekt der Psyche (Rückgriff auf bewährte Verhaltensmuster) und des Körpers (z.B. Abhärtung von Haut und Knochen nach zahlreichen Hängungen, verringerte Druckempfindlichkeit an manchen Stellen) ist also hinzu zu rechnen, wenn man die Schmerzhaftigkeit von z.B. Hängefiguren beurteilen möchte.
1) Klinger, Anna: Subjektives Schmerzemfpinden. Spüren Frauen Schmerzen stärker als Männer?, Artikel vom 24.04.2014 im Onlinemagazin unter: http://www.spektrum.de/frage/spueren-frauen-schmerzen-staerker-als-maenner/1258486 (Abruf am 01.06.2014)
2) Elisabeth List /1998: „Schmerz – Selbsterfahrung als Grenzerfahrung“, in: Maria Wolf/Walter/Rathmayr (Hrsg.): Körper-Schmerz. Intertheoretische Zugänge, Innsbruck 1998, S. 1f.
3) Elisabeth List /1998: „Schmerz – Selbsterfahrung als Grenzerfahrung“, in: Maria Wolf/Walter/Rathmayr (Hrsg.): Körper-Schmerz. Intertheoretische Zugänge, Innsbruck 1998, S. 8f.
Und: Dietrich, Julia: Körper, Ethik, Experiment: Überlegungen zur ethischen Relevanz des Unverfügbaren im Erleben von Lust und Schmerz, in: Pethes, Nicolas; Schicktanz, Silke (Hrsg.): Sexualität als Experiment. Identität, Lust und Reproduktion zwischen Science und Fiction, Frankfurt/Mail 2008, S. 245-252.